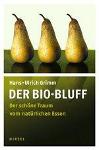Isabelle Meister wirkt nicht wie eine Greenpeace-Aktivistin aus dem Schlauchboot. Sie ist zierlich, dunkle Haare, schwarzes Kleid, sogar lackierte Fingernägel. Sie kämpft hier zusammen mit etwa 30 Greenpeace-Leuten für eine saubere Natur.
Greenpeace ist ja so eine Art Öko-Multi. Die Zentrale in Peking liegt in einer Gegend mit lauter Geschäftshäusern. Die anderswo üblichen Garküchen und Straßenhändler gibt es hier nicht. Chinesen-Essen zum Mitnehmen aus Plastikschalen gibt es in einem kleinen, cleanen Laden nebenan, in dem es auch Toblerone gibt, Pringles-Chips, Kinder-Schokolade und Wrigleys Kaugummi.
Oben die Greenpeace-Etage. Ein kleines Großraum-Büro, meist junge Chinesen sitzen an Computern, zwischen ihnen Trennwände, Zimmerpflanzen. Wir sitzen in der Besprechungs-Ecke am Panoramafenster, Hocker, Sitzkissen, ein niedriger Holztisch.
Die Zahlen sind "extrem erschreckend", sagt Frau Meister; ihr scheint die ganze Angelegenheit trotz aller Professionalität irgendwie nahezugehen. Sie blättert in einer Untersuchung, in der es um Maßnahmen gegen den ungezügelten Gifteinsatz in Chinas Landwirtschaft geht: "Policy for Reducing Non-Point-Pollution from Crop Production in China".
Die Überraschung: Es sind es vor allem die kleinen Bauern, die das Gift im Übermaß einsetzen. Andererseits ist es auch wieder keine Überraschung. Denn es gibt in China vor allem Kleinbauern. 600 bis 800 Millionen seien es. Natürlich gebe es auch Agro-Fabriken.
Die kleinen Bauern als Landverpester. Dabei sind sie doch so sympathisch und ihre Höfe so idyllisch, mit Hund und Katze und Huhn. Es wäre doch schön, wenn sie Zukunft so aussähe.
Auch Frau Meister ist keine Bauernhasserin. Frau Meister lobt sie auch: Die kleinen Bauern seien tatsächlich die Stützen von Chinas Landwirtschaft. Sie hätten große Verdienste und nährten das Land mit einigem Erfolg, woran auch die offizielle Politik ihren Anteil hatte, meint die Frau von Greenpeace "China hatte so viele Hungersnöte, bei denen viele Leute gestoben sind, und das ist noch nicht so lange her. Da hat die Regierung schon sehr viel erreicht."
Und ihre Höfe seien wirklich klein, hätten zumeist nur einen Hektar Land. "Was hier ein Bauernhof ist, ist in den meisten anderen Ländern ein Garten", sagt Frau Meister. Oder ein Garten mit Weiher, wie bei der Familie Wei mit ihrem Idyll im Grünbereich von Chongqing, der größten Stadt der Welt (DR. WATSON vom 29. August). Das Idyll scheint also wirklich typisch zu sein für die Landwirtschaft im Reich der Mitte.
Doch Frau Meister hat irgendwie keinen Sinn fürs Idyllische. Sie findet sogar: "Die Betriebe sind zu klein."
Denn bei vielen fehle einfach das Wissen im Umgang mit Pestiziden und Kunstdünger. Sie spritzen einfach zu viel. Und: "Viele Farmer wissen auch nicht, dass sie das Pestizid vielleicht nicht am Tag vor der Ernte einsetzen sollen." Sinnvoll wären da strenge Vorgaben und Kontrollen. Aber: Die Kontrollen seien naturgemäß schwierig bei bis zu 800 Millionen Bauern.
Auf der anderen Seite haben die kleinen Bauern auch einen riesigen Schatz an Wissen - über die traditionelle Art von Landbau, von Schädlingsbekämpfung. Das soll jetzt auch wieder zunehmend nutzbar gemacht werden. Es gibt Versuche, beispielsweise Entenaufzucht und Reisanbau zu verbinden. Die Enten watscheln durchs Reisfeld und fressen die Schädlinge weg. Oder sie bauen verschiedene Reissorten gleichzeitig an, um so die Widerstandskraft der Pflanzen zu erhöhen. So etwas wird von Universitäten unterstützt, von Nichtregierungsorganisationen oder Entwicklungshelfern.
Manche Kleinbauern schließen sich auch zu Gemeinschaften zusammen, um ökologisch zu produzieren. Kann man denen denn trauen" Öko aus China, so echt wie die Rolex und die Tasche von Louis Vuitton"
Nun ja, meint die Frau aus der Schweiz: Auf der einen Seite gebe es das "Greenfood" Programm der Regierung. Ökologisch nicht im engeren Sinne. Auf der anderen Seite gebe es die Standards der internationalen Bio-Verbände unter Dach der internationalen IFOAM-Orgamisation. Was ist mit denen? "Ich denke, IFOAM kann man schon trauen Die Kontrollen bei denen sind streng."
Aber wie groß müssen denn jetzt die Bauernhöfe sein, damit sie in Zukunft die Nahrung sicher produzieren können? Wie sollen sie organisiert sein? Die Riesenfarmen in Amerikas Mittlerem Westen, mit Gen-Mais von Monsanto, die sind ja auch nicht als musterhafte Naturschoner bekannt. Wenn es um die Zukunft der Nahrung geht: Wo liegt denn nun das rechte Maß?
"Aus unserer Sicht?" fragt Frau Meister. Ja, bitte. Greenpeace ist doch eine gewisse Instanz. Kann Maßstäbe setzen.
Doch da ist auch der Öko-Multi einstweilen keine große Hilfe. Auch bei Greenpeace ist der Denkprozess noch im Gange.: "Wir haben uns diesbezüglich noch keine Meinung gebildet", sagt sie. Die Frau aus der Schweiz ist da ganz ehrlich. Was ja auch ganz sympathisch ist. Die Frage nach der Zukunft der Nahrung ist weiter offen, nicht nur im Reich der Mitte.